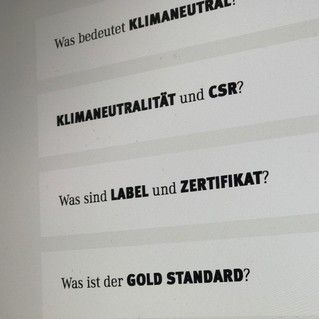Auf die richtigen Gründe und Kommunikation kommt es an.
Trotz der Bekanntheit des Themas Klimaneutralität verzeichnen wir derzeit eine hohe Nachfrage nach unseren CO₂-Bilanzierungs- und Klimaneutralstellungs-Dienstleistungen. Dabei stellen wir jedoch fest, dass die externe Kommunikation dieses Engagements gegenüber Kunden, Partnern und anderen Interessengruppen oft unzureichend, irreführend oder sogar falsch ist. Es ist völlig ungeeignet, das Thema Klimaneutralität lediglich als Marketinginstrument oder zusätzliches Label auf Verpackungen zu verwenden. Unternehmen sollten es auch nicht zur Schmückung von Prozessen oder sogar des gesamten Unternehmens verwenden. Obwohl das "klimaneutral"-Label und die Tracking-ID-Abfrage von natureOffice transparent gestaltet und umfassend zertifiziert sind, sollten Unternehmen dennoch das Logo korrekt, ehrlich und transparent in ihre Marketingstrategie einbinden.
Fordern Sie bitte unsere detaillierten Kundeninformationen an!
Was bedeutet klimaneutral?
Anzeigen
Schliessen
Der Mechanismus der Klimaneutralität geht auf das Kyoto-Protokoll (https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf) zurück. Gemäß der Definition des Weltklimarats IPCC definiert er die Klimaneutralität wie folgt: Wenn eine Emissionsquelle (z.B. Unternehmensaktivität) durch eine Emissionssenke (Klimaschutzprojekt) ausgeglichen wird, wird dem Klima kein zusätzlicher Schaden zugefügt. Dann sprechen wir von einem Begriff, der unter dem Wort „Klimaneutral“ bekannt ist. Quelle IPCC (https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/)
Klimaneutralität ist ein umweltpolitisches Ziel, durch Produktion und Konsum keinen weiteren zusätzlichen, negativen Einfluss auf das Klima auszuüben. Dahinter steckt die Annahme, dass das Klimasystem ein bestimmtes Maß an Treibhausgasemissionen puffern kann, ohne dass es zu signifikanten Einflüssen auf das Klima kommt. Klimaneutral bedeutet hingegen nicht, dass keine Treibhausgase entstanden sind oder das Unternehmen soweit reduzieren und vermeiden konnte, dass es emissionsfrei ist. Klimaneutral können Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmen sein, wenn nach der Ermittlung der CO2e-Bilanz (z. B. nach dem GHG-Protocol) die Treibhausgasemissionen ausgeglichen werden. Neben dem freiwilligen Engagement im Klimaschutz ist die Vermeidung bzw. die Reduktion von Treibhausgasen zwingend geboten und wichtig, laut IPCC aber keine Voraussetzung, um Klimaneutralität zu erreichen. Mehr Informationen, was Unternehmen über den CO2e-Ausgleich hinaus dazu beitragen, CO2e-Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren, bzw. welche Systemgrenzen für den CO2e-Ausgleich berücksichtigt wurden, erfragen Sie bitte bei dem o.g. Unternehmen selbst.
Was Unternehmen über den reinen Ausgleich von Treibhausgas-Emissionen (nach Kyoto) hinaus unternehmen, um Treibhausgase zu vermeiden oder zu reduzieren, sollte auf den Webseiten der Unternehmen dargelegt sein.
Was bedeutet klimaneutral nicht?
Anzeigen
Schliessen
Klimaneutral durch CO2-Ausglkeich bedeutet nicht, dass keine Treibhausgase, beispielsweise bei einem Produktionsprozess, entstanden sind oder das Unternehmen durch innovative Technik ihren Treibhausgasausstoß soweit reduzieren und vermeiden konnte, dass es emissionsfrei ist.
Was sind CO₂-Zertifikate?
Anzeigen
Schliessen
Andere gebräuchliche Begriffe: CO₂-Zertifikate, Klimaschutzzertifikate, Emissionszertifikate. CO₂-Zertifikate werden allgemein in der Mengeneinheit 1 Tonne CO2e (e=Äquivalente) gehandelt. Andere klimaschädliche Treibhausgase wie beispielsweise Methan werden in ihrer Wirkung in eine entsprechende Menge CO₂ umgerechnet, sogenannte CO₂-Äquivalente. 1 Zertifikat entspricht einer Einsparung einer Tonne CO₂-Äquivalent durch ein Klimaschutzprojekt. Für den Handel mit CO₂-Zertifikaten gibt es zwei Märkte, den Verpflichtenden, auf staatlicher Ebene und den Freiwilligen, den sogenannten Voluntary Market. Durch unabhängige Institutionen wie z.B. den Gold Standard werden Klimaschutzprojekte, aus denen Zertifikate generiert werden, zertifiziert und geprüft.
Warum freiwilliger Klimaschutz?
Anzeigen
Schliessen
Im freiwilligen Klimaschutz geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Und genau wie jeder ein Teil dieses Problems ist, kann auch jeder ein Teil der Lösung sein.
Was ist freiwillige Kompensation?
Anzeigen
Schliessen
Als freiwillige CO₂-Kompensation (kurz: Kompensation; Lat.: compensare = ausgleichen; engl.: Carbon Offsetting) bezeichnet man eine freiwillige Zahlung für eine zusätzliche Klimaschutzmaßnahme, die die mit einem Prozess verbundene Menge an Treibhausgasemissionen an einem anderen Ort einspart. Die Begriffe CO₂-Kompensation, Kompensation, freiwillige Kompensation oder Kompensationszahlung werden synonym im hier beschriebenen Sinne verwendet.
Sind freiwillige Kompensationszahlungen Spenden?
Anzeigen
Schliessen
Nein. Aus unserer Sicht sind die Kosten, die Sie für den Ausgleich Ihrer CO₂-Emissionen leisten, keine Spenden für den Klimaschutz, sondern stellen eine sinnvolle Investition in eine messbare Reduktion Ihrer CO₂-Emissionen dar.
Muss freiwilliger Klimaschutz immer mit einem schlechten Gewissen verbunden sein?
Anzeigen
Schliessen
Nein. Besonders im Bereich des freiwilligen Kompensationsmarktes ermöglicht erst der Handel mit CO₂-Zertifikaten ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt aus dem Boden zu stampfen und dieses über eine, meist sehr lange Laufzeit hinweg, zu finanzieren. Zertifikatskäufer, egal ob Unternehmen, Organisationen oder auch Privatpersonen leisten also einen aktiven und tatsächlichen Beitrag zum Klimaschutz. Mit "Gewissen erleichtern" oder "sich von der CO₂-Sünde freizukaufen" hat das ganz klar nichts zu tun. Sollte es jedoch so sein, dass man durch den CO₂-Ausgleich sein Gewissen erleichtern könnte, wäre auch diese Möglichkeit um Längen besser als nichts zu tun.
Soll ich CO₂-Emissionen ausgleichen?
Anzeigen
Schliessen
Klimaprobleme durch Ignoranz oder Verdrängung auszusitzen, kann keine Lösung sein. Um Klassen besser ist es, sich beispielsweise durch die Ermittlung seines CO2-, Footprints seiner CO₂-Emission bewusst zu werden, sie zu reduzieren und am besten abzustellen. Solange dieses "Abstellen" jedoch noch nicht möglich ist, stellt der CO2-Ausgleich die beste Maßnahme dar, schnell und besonders effektiv Emissionen herunterzufahren. Dies schafft Zeit für die Entwicklung weiterer Innovationen oder Mechanismen im Bereich des freiwilligen Klimaschutzes. Also: JA, es macht Sinn seinen CO2-, Fußabdruck zu kennen - und JA, CO₂-Emissionen ausgleichen ist eine Investition in die Zukunft!
Der Ansatz Vermeiden – Reduzieren - Kompensieren wird oft mit der Aussage verknüpft, dass NUR „nicht vermeidbare“ Treibhausgasemissionen kompensiert werden sollten. Ist das richtig?
Anzeigen
Schliessen
Nein. Betrachtet man die Unternehmenskommunikation einiger Firmen, könnte man zwar glauben, dass nur die „nicht-vermeidbaren“ CO₂-Emissionen die Erlaubnis zur Kompensation erhielten. Voraussetzung vor der Kompensation sei erst einmal Emissionen zu vermeiden, anschließend nicht vermeidbare CO₂-Emissionen durch verschiedene Effizienzmaßnahmen zu verringern und erst dann, die CO2-, Emissionen, die nicht weiter zu reduzieren sind, zu kompensieren. Dieser Ansatz hat sicher seine Berechtigung, führt aber unweigerlich dazu, die Kompensation auf der Rangliste der Klimaschutzmaßnahmen auf den letzten Platz zu verbannen. Ebenfalls bieten die bisher nicht durchgeführten Vermeidungs- und Reduzierungsmaßnahmen ausreichend Legitimation dafür, weshalb man als Unternehmen CO₂-Emissionen erst einmal nicht zu kompensieren braucht. Ebenfalls stellt der Ansatz, dass nur „nicht vermeidbare“ Treibhausgasemissionen ausgeglichen werden sollten, eine Vorbedingung dar, die so nicht existiert. Denn wer bestimmt, was vermeidbar ist? Ist eine Urlaubsreise oder eine Autofahrt vermeidbar? Da dies also subjektiv ist, kann es eine Vorbedingung dieser Art nicht geben.
Wo liegt der Ursprung der Klimaneutralität?
Anzeigen
Schliessen
Das Prinzip der Klimaneutralität, so wie es heute im freiwilligen Klimaschutz zur Anwendung kommt, basiert auf dem Kyoto-Protokoll, das 1997 verabschiedet wurde. Das Kyoto-Protokoll ist ein Zusatzprotokoll zur Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) mit dem Ziel des globalen Klimaschutzes.
Das im Jahr 2005 in Kraft getretene Abkommen regelt erstmals völkerrechtlich verbindliche Ziele für den Ausstoß von Treibhausgasen. Dabei wurde definiert, dass Emissionen, die an einem Ort entstehen, an einem anderen Ort vermieden werden können. Somit ist der Handel von Emissionsrechten das zentrale Instrument des Kyoto-Protokolls.
Was ist "freiwillige Kompensation"?
Anzeigen
Schliessen
Als freiwillige CO2-Kompensation (kurz: Kompensation; Lat.: compensare = ausgleichen; engl.: Carbon Offsetting) bezeichnet man eine freiwillige Zahlung für eine zusätzliche Klimaschutzmaßnahme, die die mit einem Prozess verbundene Menge an Treibhausgasemissionen an einem anderen Ort einspart. Die Begriffe CO2-Kompensation, Kompensation, freiwillige Kompensation oder Kompensationszahlung werden synonym im hier beschriebenen Sinne verwendet.
Verlangt echtes Vermeiden und Reduzieren nicht eine ganz strenge Umstellung unseres Konsums?
Anzeigen
Schliessen
Seien wir doch mal ehrlich. Wir wollen das Klima (und die Umwelt) schützen und die Erderwärmung eindämmen. Aber welchen Preis sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Sind wir bereit, zum Schutz unserer Umwelt und zur Sicherung der Zukunft unserer Kinder Verzicht zu üben? Worauf wollen oder können wir verzichten? Und was bedeutet Verzicht auf globaler Ebene? Verzichten wir künftig auf Bananen oder Kaffee, Produkte, die oft lange Weg bis zum Konsumenten zurücklegen müssen? Und was sagen wir den Bananen, Farmern oder den Kaffeebauern? Vielleicht: "Sorry, wir schützen jetzt das Klima und wir kaufen eure Produkte nicht mehr!"? Es wird in der Zukunft nicht ausreichen, mit schönen Bildern von harmonischem, nachhaltigem Kaffeeanbau mit zufriedenen Kaffeebauern zu sprechen, oder nur noch Baumwollshirts zu kaufen die irgendwie zertifiziert sind! Nein! Das Klima zu schützen, bedeutet für jeden von uns Abstriche zu machen, den Konsum einzuschränken, Dinge länger zu nutzen, keine kurzen Strecken mit dem Flugzeug zu fliegen und zu schauen, ob die Gebäude, in denen wir leben, energieoptimiert sind. Diese Punkte stehen selbstverständlich für eine Vielzahl von Dingen, die wir alle gemeinsam und natürlich letzten Endes, jeder für sich, in Angriff nehmen müssen.
Muss freiwillige Kompensation immer mit
einem schlechten Gewissen verunden sein?
Ist das nicht alles ABLASSHANDEL?
Anzeigen
Schliessen
einem schlechten Gewissen verunden sein?
Ist das nicht alles ABLASSHANDEL?
Nein. Besonders im Bereich des freiwilligen Kompensationsmarktes ermöglicht erst der Handel mit CO2-Zertifikaten ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt aus dem Boden zu stampfen und dieses über eine, meist sehr lange Laufzeit hinweg, zu finanzieren. Zertifikatskäufer, egal ob Unternehmen, Organisationen oder auch Privatpersonen leisten also einen aktiven und tatsächlichen Beitrag zum Klimaschutz. Mit "Gewissen erleichtern" oder "sich von der CO2-Sünde freizukaufen" hat das ganz klar nichts zu tun. Sollte es jedoch so sein, dass man durch den CO2-Ausgleich sein Gewissen erleichtern könnte, wäre auch diese Möglichkeit um Längen besser als nichts zu tun.
CO₂-Ausgleich ist nicht die Lösung für den Klimawandel
Anzeigen
Schliessen
Aber Klimaneutralität durch CO₂-Ausgleich kann ein Baustein sein, der uns Zeit verschafft, bis wir effizientere Technologien entwickelt haben, die deutlich weniger CO₂ emittieren als bisher bzw. bis wir unser Konsumverhalten entsprechend den Notwendigkeiten angepasst haben. Vielleicht haben wir dann auch eine Lösung für die massive Ungerechtigkeit in der Welt und den ungleich verteilten Reichtum. Lösungen gegen Hungersnöte und Wasserknappheit und gegen politisch motivierte Kriege.
Was sind Klimaschutzprojekte und welche Arten gibt es?
Anzeigen
Schliessen
Es gibt unterschiedliche Arten von Projekten, mit denen man CO₂-Emissionen kompensieren kann. Einige Projekte investieren in Emissionseinsparungen durch den verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energiequellen, andere entziehen der Atmosphäre Kohlendioxid (CO₂) durch Wiederaufforstung und wieder andere vermeiden den Ausstoß von Treibhausgasen in Industrieprozessen. Die Projekte unterscheiden sich auch bezüglich ihres Umfangs. Es gibt kleinere Projekte, die auf Gemeindeebene stattfinden, und größere, die eine ganze Industrieanlage umfassen können. Die verschiedenen Projektarten haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, hinsichtlich ihres Potenzials für die Treibhausgasreduktion, aber auch hinsichtlich der Nebeneffekte, die sie z.B. auf Biodiversität oder die Beschäftigungssituation in der Region haben. Klimaschutzprojekte müssen international anerkannte Kriterien und Standards erfüllen und entsprechend zertifiziert werden.
Die wichtigsten Kriterien sind die folgenden:
- Zusätzlichkeit: Es muss sichergestellt sein, dass ein Projekt nur, aufgrund der aus dem Emissionshandel erzielten Gelder, umgesetzt werden kann. Das Klimaschutzprojekt muss also auf Erlöse aus dem Emissionshandel zur Deckung des Finanzierungsbedarfs angewiesen sein.
- Ausschluss von Doppelzählungen: Es muss sichergestellt werden, dass die eingesparten CO₂-Emissionen nur einmalig (beim Eigentümer der Zertifikate) angerechnet werden. Das bedeutet insbesondere, dass Zertifikate nur einmal verkauft werden dürfen.
- Dauerhaftigkeit: Die Emissionseinsparungen müssen dauerhaft erfolgen, z.B. muss die Bindung von CO₂ in Wäldern langfristig erfolgen.
Regelmäßige Überprüfung durch unabhängige Dritte: Klimaschutzprojekte müssen in allen genannten Kriterien in regelmäßigen Zeiträumen durch unabhängige Dritte (z.B. TÜV, SGS, DNV) überprüft werden.
Aufforstung oder erneuerbare Energien?
Anzeigen
Schliessen
Welche Vorteile bieten Aufforstungsprojekte gegenüber technischen Projekten? Nur bei Aufforstungsprojekten wird durch den Mechanismus der Fotosynthese heute in der Atmosphäre befindliches CO₂ in der Biomasse des Baumes gebunden und sofort und dauerhaft der Atmosphäre entzogen. CO₂ wird also direkt gebunden. Aufforstungsprojekte helfen uns also dabei, dem gegenwärtigen Problem des zu viel CO₂ in der Atmosphäre entgegenzuwirken. Erneuerbare Energien Projekte hingegen vermeiden die CO₂-Emissionen nur indirekt durch Vermeidung in der Zukunft. Für uns als natureOffice liegen die vielen Vorteile ganz klar bei den vielen Co-Benefits, die Aufforstungsprojekte mit sich bringen. Allen voran die Sicherung und die Schaffung von Biodiversität, die Stabilisierung und Schaffung der vielen Schutzfunktionen der Wälder, wie Erosions- oder Wasserschutz. Nicht zu vergessen die langfristigen Arbeitsplätze in den Projektregionen, die die Verbesserung der Lebensumstände der lokalen Bevölkerung mit sich bringt. Diese Vorteile bietet ein Windpark beispielsweise, finanziert von einem Energieunternehmen in China, nicht. Es geht nicht darum, was besser oder schlechter ist. Wir brauchen beide Formen, um die gegenwärtigen und zukünftigen Probleme langfristig zu lösen.
Double Counting, was ist das?
Anzeigen
Schliessen
Im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten in Deutschland oder dem Kauf von Kompensationszertifikaten zur Stilllegung hört man diese Begriffe häufig. Aber was ist eigentlich darunter zu verstehen?
Unter einer Doppelzählung wird ein negatives Szenario verstanden, in dem eine Emissionsreduktion zweimal geltend gemacht oder verkauft wird. Doppelzählung ist ein Risiko, das die Umweltintegrität untergraben kann.
Insbesondere nationale Projekte hier in Deutschland bergen häufig das Risiko der Doppelzählung. Deutschland hat – als Mitglied der EU – das Kyoto-Protokoll unterzeichnet und sich somit rechtsverbindlich zu Emissionsbeschränkungen und -minderungen verpflichtet. Deutschland ist somit verpflichtet seine Emissionen zur Aufforstung, Wiederaufforstung und Entwaldung zu berichten. Im Rahmen der zweiten Verpflichtungsperiode wurden zusätzlich die Ackerland- und Grünlandbewirtschaftung in die Berichterstattung im Rahmen des nationalen Emissionsinventars einbezogen.
Das bedeutet, dass Reduktionen aus nationalen Waldprojekten in Deutschland im nationalen Emissionsinventar positiv angerechnet werden. Würden diese Reduktionen Kunden zur Kompensation von CO₂-Emissionen angeboten, wäre dies ein klarer Fall von Doppelzählung.
Bei Registrierung und Stilllegung kann dem Problem des Double Counting wie folgt begegnet werden: Die ausgegebenen Zertifikate eines Projekts sollten an zentraler Stelle registriert werden, in einem sogenannten Register. Register vergeben Seriennummern und verfolgen die Besitzverhältnisse der Emissionszertifikate. Die Information darüber, ob Zertifikate für Kompensationszwecke bereits genutzt und damit „stillgelegt“ wurden, ist hier öffentlich zugänglich. So wird vermieden, dass stillgelegte Zertifikate erneut verkauft oder weiter gehandelt werden können. Es gibt kein allgemeingültiges öffentliches Register für Zertifikate des freiwilligen Marktes. Relevant sind insbesondere zwei Registerbetreiber, die APX und Markit, die beiden größten Register im Bereich freiwillige CO₂ Transaktionen.
Was ist der Gold Standard, was der VCS und wie unterscheiden sie sich?
Anzeigen
Schliessen
Dabei handelt es sich um Klimaschutzstandards, die auf freiwilliger Basis, Klimaschutzprojekte zertifizieren. Dabei muss ein Klimaschutzprojekt den Regeln der Standards entsprechen. Regeln sind zum Beispiel die Zusätzlichkeit, das bedeutet, dass ein Projekt zusätzlich ist und nicht schon ohnehin geplant war oder sowieso umgesetzt werden würde. Weitere Themen, die geprüft werden sind keine Kinderarbeit, keine Landvertreibung, die Einhaltung der lokalen Gesetze und vieles mehr. Diese Kriterien werden zu Beginn und während der gesamten Projektlaufzeit durch unabhängige Auditoren geprüft. Der Gold Standard ist der bekanntere Klimaschutzstandard, in der Leistung sind aber andere Klimaschutzstandards wie zum Beispiel der VCS absolut vergleichbar und gleichwertig.
Was bewirke ich, wenn ich in Klimaschutzprojekte investiere?
Anzeigen
Schliessen
Erst das Engagement im freiwilligen Klimaschutz macht es möglich, Klimaschutzprojekte überhaupt weltweit zu entwickeln und zu betreiben.
Wie kann ich nachvollziehen, was mit meinem Geld passiert?
Anzeigen
Schliessen
Die Klimaschutzprojekte sind durch den Gold Standard (oder VCS) zertifiziert und werden über die gesamte Laufzeit kontrolliert. Das bedeutet, dass auch die Stilllegung der Zertifikate durch den Standard kontrolliert wird. So ist gewährleistet, dass Zertifikate nicht mehrfach verkauft werden können. Nur durch die Zusätzlichkeit, also den Verkauf von CO₂-Zertifikaten können diese Projekte umgesetzt werden.
Warum ist das Projekt nicht in Deutschland?
Anzeigen
Schliessen
Aus dem Kyoto-Protokoll geht hervor, in welchen Ländern Klimaschutzprojekte für den freiwilligen Markt zugelassen sind. Das sind Schwellen- und Entwicklungsländer. Der Grund hierfür ist, dass neben dem Klimaschutz auch die sozialen Strukturen verbessert, werden sollen. Dazu gehören beispielsweise die Wasser- und Energieversorgung, der Bau von Schulen und ganz konkret die Förderung von Frauen durch Frauenprojekte. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Umsetzung von Klimaschutzprojekten in den Schwellen- und Entwicklungsländern wesentlich günstiger ist, jedoch mit dem gleichen Effekt auf das Weltklima. In Deutschland können auch Projekte, die das Klima schützen initiiert werden, allerdings generieren diese Projekte keine Klimaschutzzertifikate.
Weshalb gibt es echte, zertifizierte Klimaschutzprojekte immer nur in Afrika oder Indien, wieso nicht in Deutschland?
Anzeigen
Schliessen
Für das Weltklima spielt es keine Rolle, wo der CO₂-Ausgleich stattfindet. Für die Ökonomie schon. Deshalb machen Klimaschutzprojekte grundsätzlich dort mehr Sinn, wo die natürlichen Gegebenheiten vorhanden sind und die Projekte kosteneffizient zu realisieren sind. Ein wichtiger Nebeneffekt: Klimaschutzprojekte in der Dritten Welt fördern den Technologietransfer und leisten aktiv Hilfe zur Selbsthilfe. Ein weiteres Problem bei Klimaschutzprojekten in Deutschland steht im Zusammenhang mit der möglichen doppelten Anrechnung. Eine indirekte doppelte Anrechnung könnte dann stattfinden, wenn fossiler Strom aus einem Kraftwerk beispielsweise durch Strom aus einem Windpark ersetzt wird. Durch den regenerativ erzeugten Strom würde das nationale Emissionsbudget entlastet und zusätzliche Emissionsrechte erzeugt werden. Waldflächen unterliegen strengen Kontrollen und Auflagen. So müssen Waldflächen nach Brand oder Windbruch zwingend aufgeforstet werden. Aus dieser Aufforstung kann kein Klimaschutzprojekt entstehen, da in diesem Falle das wichtige Kriterium der Zusätzlichkeit nicht gegeben ist. Wir, möchten jedoch das Eine tun, ohne das Andere zu lassen, da wir speziell in deutschen Wäldern mit vielfältigen Problemen zu tun haben, die u.a. auch durch den Klimawandel entstanden sind. Daher haben wir uns auch für ein Engagement in Deutschland entschieden und fördern wichtige Waldökologieprojekte.
Was sind Waldökologieprojekte in Deutschland?
Anzeigen
Schliessen
Auch in Deutschland ist der Klimawandel angekommen. Auf zahlreichen Waldflächen in Deutschland wachsen, aus historischen Gründen, die bis in das 17. Jahrhundert zurückreichen, Standort falsche Bäume. Bäume, die aufgrund natürlicher Vegetation vielleicht eher im Norden als im Süden von Deutschland wachsen sollten. Oder sehen wir uns den zurückliegenden Sommer mit seiner überdurchschnittlichen hohen Temperatur und der langen Trockenphase an, dann verstehen wir schnell, dass auch in den deutschen Wäldern Klimaanpassungen erfolgen müssen. Statt immer nur den Staat zu rufen, kümmern wir uns, gemeinsam den regionalen Forstbetrieben um Waldökologieprojekte in Deutschland. Das kann der Waldumbau in den Alpen, wo wir Weißtanne und Buche nachpflanzen, genau so sein wie die Pflege von Teilstücken im Biosphärenreservat in der Rhön oder die Moorwiedervernässung im Hunsrück sein. In Werdohl, dessen Wälder von extremen Stürmen heimgesucht wurde, pflanzen wir gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden die Sturmflächen wieder auf.
Wie ist die Methodik zur Ermittlung des CCF?
Anzeigen
Schliessen
Der CO₂-Fußabdruck des Unternehmensstandorts wird gemäß dem Greenhouse Gas (GHG) -Protocol (WRI und WBCSD, 2004) oder ISO 14064 berechnet. Dies berücksichtigt in jedem Fall alle direkten Treibhausgasemissionen (Scope 1) und alle indirekten Emissionen aus dem Verbrauch von Strom, Fernwärme und Fernkälte (Scope 2). Die Berücksichtigung von allen oder ausgewählten indirekten Emissionen (Scope 3) aus vor- und nachgelagerten Prozessen ist optional.
Wie ist die Methodik zur Ermittlung des PCF?
Anzeigen
Schliessen
Der CO₂-Fußabdruck von Produkten wird gemäß dem Greenhouse Gas (GHG) -Protocol (WRI und WB- CSD, 2004) oder ISO 14067 berechnet. Dies berücksichtigt in jedem Fall (cradle-to-gate) alle direkten Treibhausgasemissionen der Produktion, alle indirekten Emissionen aus dem Verbrauch von Strom, Fernwärme und Fernkälte und vorgelagerten indirekten Emissionen. Die zusätzliche Berücksichtigung von allen indirekten Emissionen nachgelagerter Prozesse finden insbesondere bei Verbraucher-Produkten Anwendung (cradle-to-grave). Berücksichtigte Kategorien bei der Bewertung sind: Energieverbrauch/ Wasserverbrauch/ Eingekaufte Rohstoffe und Materialien (Produktion und Anlieferung) / Verpackungsmaterial (Produktion und Anlieferung)/ Abfallentsorgung und Recycling/ Mobilität: Anreise der Mitarbeiter und geschäftliche Mobilität.
Was sind CO₂-ÄQUIVALENTE (CO2E)? SCHLIESSEN
Anzeigen
Schliessen
Was CO₂ ist, wissen heute die allermeisten: Kohlenstoffdioxid (CO₂) ist ein wichtiges Treibhausgas und wird beispielsweise von Flugzeugen und Fahrzeugen ausgestoßen. Zu viel CO₂ Emissionen tragen negativ zur Klimaentwicklung bei, sie begünstigen die Erderwärmung. Oft findet man in Publikationen oder Dokumentationen zu CO₂-Bilanzen nicht die Abkürzung CO₂, sondern CO2e. Was hat es mit dieser Abkürzung auf sich?
CO2e ist eine Maßeinheit, die den Effekt aller Treibhausgase auf unser Klima vergleichbar macht und alle, im Kyoto Protokoll genannten Treibhausgase somit berücksichtigt. Dazu gehören Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH4), Lachgas (NO2), halogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (u.a. CHF3), perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe (CF4) und Schwefelhexafluorid (SF6), welche unterschiedlich stark zum Treibhauseffekt beitragen. Sie verbleiben unterschiedlich lang in der Erdatmosphäre und sind sehr viel klimaschädlicher sind als das bekannte CO₂, da sie um ein vielfach höheres Treibhauspotenzial besitzen. In Deutschland jedoch ist, gemessen an dieser Treibhausgaswirkung CO₂, mit einem Anteil von 88 %, das wichtigste Treibhausgas. Aufgrund ihres höheren Treibhauspotentials dürfen die anderen Gase jedoch nicht vernachlässigt werden. Wie viel schädlicher als CO₂ ein Treibhausgas nun wirklich ist, kann mithilfe von CO₂-Äquivalenten (CO2e) berechnet werden.
Beispiel Methan:
Die Wirkung einer Tonne CO₂ wird, meistens über einen Zeitraum von 100 Jahren, mit der Wirkung einer Tonne Methan verglichen. Nun ist eine Tonne Methan etwa 25-mal klimaschädlicher als eine Tonne CO₂. Daher entspricht eine Tonne Methan etwa 25 Tonnen CO₂-Äquivalenten (CO2e).
Anmerkung zum Logo klimaneutral durch CO₂-Ausgleich: Wir berücksichtigen bei der Erstellung der CO₂-Bilanzen alle Treibhausgase.
Gibt es Standards und Normen, die für die Bilanzierung beachtet werden müssen?
Anzeigen
Schliessen
Ja, die gibt es. Je nach Wunsch erstellen wir Ihnen Ihre Klima-Bilanz nach
- DIN ISO 14064-1 (PCF)
- DIN ISO 14064 (CCF)
oder den Corporate Standard des Greenhouse Gas Protocols für
- CCF Scope 1 und 2
- den Corporate Value Chain Standard für CCF Scope 3
- oder den Product Life Cycle Standard für PCFs.
Die DIN ISO 14064-1 bietet Spezifikation mitsamt einer Anleitung zur quantitativen Bestimmung und Berichterstattung von Treibhausgasemissionen und von Treibhausgassenken auf Organisationsebene. Das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) ist der anerkannteste internationale Standard zur Treibhausgasbilanzierung von Unternehmen und Projekten. Treibhausgasemissionen werden nach der GHG Protocol Logik in drei Entstehungsbereiche – sog. „Scopes“ - eingeteilt:
- Direkte Emissionen, die durch die Aktivitäten des Unternehmens vor Ort resultieren (z.B. Gasverbrauch)
- Indirekte Emissionen aus eingekaufter Elektrizität, Wärme und Kühlung
- Indirekte Emissionen aus der vor- und nachgelagerten Lieferkette (z.B. gehören Emissionen der Assets in unseren Investmentportfolio zu Kategorie 3.15 Investments)
Wie aufwendig ist die Erstellung einer Bilanz?
Anzeigen
Schliessen
Der Aufwand für die Erstellung einer Bilanz ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, was bilanziert wird. Besteht ein Produkt beispielweise nur aus wenigen Rohstoffen oder steht ein komplexer Produktionsprozess aus den verschiedensten Materialen dahinter? Je exakter und differenzierter die Daten bewertet werden sollen und je tiefer man in die Lieferketten einsteigen möchte hängt desto aufwendiger, aber auch genauer und detaillierter wird Ihre Klima-Bilanz. Der aufwendigste Schritt bei einer Bilanzierung liegt in der Sammlung der notwendigen Aktivitätsdaten, mit denen dann die Emissionsmengen ermittelt werden. Dabei sind wir auf die Unterstützung des Unternehmens angewiesen, die diese Aktivitätsdaten bereits stellen muss.
Welche Daten benötige ich für die Erstellung einer Bilanz?
Anzeigen
Schliessen
Zunächst sollten Sie die Ziele für die Bilanzierung definieren. Sollte es für Ihr Unternehmen gesetzlich verpflichtend sein, gelten sehr wahrscheinlich genaue Anforderungen. Falls Sie ein reines Eigeninteresse treibt, können Sie frei über den Umfang und die Berichterstattung entscheiden.
Anschließend legen Sie die operativen und unternehmensspezifischen Systemgrenzen sowie das Berichtsjahr fest. Nachdem Sie den Rahmen Ihrer Bilanz festgelegt haben, können Sie die relevanten Daten erheben (Aktivitätsdaten) und die Treibhausgasemissionen berechnen.
Aktivitätsdaten sind quantitative Maße einer Aktivität, die zu THG-Emissionen führen. Es ist ein Maß, das modelliert, was während eines bestimmten Zeitraums passiert (z. B. verbrauchte Gasmenge, gefahrene Kilometer, Tonnen fester Abfälle, die auf Deponien entsorgt werden, usw.).
Beispiele Aktivitätsdaten
- verbrauchte Menge an Kilowattstunden Strom
- verbrauchte Kraftstoffmenge
- Betriebsstunden
- zurückgelegte Strecke
Definition Emissionsfaktoren:
Anzeigen
Schliessen
Emissionsfaktoren sind quantitative Maße für THG-Emissionen, die aus einer definierten Aktivität erfolgen.
Beispiele Emissionsfaktoren:
- kg CO2e/€ Spezifikation- z.B. zur Berechnung eingekaufter Dienstleistungen
- kg CO2e/kg Material z.B. zur Berechnung eingekaufter Produktionsmaterialien
- kg CO2e/kWh Energieträger z.B. zur Berechnung von Wärmeenergie
- kg CO2e/tkm Transportart z.B. zur Berechnung von Anlieferungen
PROJECT TOGO
Bei Projekt Togo werden, nicht nur Baumpflanzungen für die CO2-Zertifikate herangezogen, sondern auch weitere Faktoren wie die effizienten Kochöfen, etc. – stimmt das?
Anzeigen
Schliessen
Nein, CO₂-Zertifikate generieren wir derzeit ausschließlich aus dem Waldprojekt. Wir werden in Zukunft ein weiteres Projekt im Bereich der energieeffizienten Kochöfen aufsetzen.
Wie viel CO₂ nehmen die Bäume in Projekt Togo im Schnitt im Jahr auf?
Anzeigen
Schliessen
Das hängt vom Baum selbst, vom Standort, von der Sonneneinstrahlung, der Pflanzdichte und von ganz vielen anderen Faktoren ab. Pauschal lässt sich das nicht sagen, da wir auf unserer Fläche ca. 89 verschiedene Baumarten haben.
Gibt es eine Möglichkeit einzusehen, wie viele Bäume im PROJECT TOGO bisher Kompensationszahlungen gepflanzt wurden?
Anzeigen
Schliessen
Nein, die Berechnung der Emissionsmenge erfolgt nicht auf den Baum heruntergebrochen, sondern über die Fläche. Wir gehen davon aus, dass pro ha ca. 12 t Kohlenstoff pro Jahr gebunden werden.
Wie oft werden im Projekt Togo neue Bäume gepflanzt?
Anzeigen
Schliessen
Wir pflanzen 2-mal jährlich, immer zur Regenzeit, neue Bäume.
Doppelzählungen im PROJECT TOGO: Ist es sichergestellt, dass die Aufforstungen nicht auch in die CO₂-Bilanz von Togo eingerechnet werden?
Anzeigen
Schliessen
Es gibt in Togo noch nicht einmal eine Behörde oder eine Institution, die sich bislang mit dieser Frage, die sich aus Paris ergeben hat, beschäftigt. Zumal neue Regeln auch nur auf neue Projekte angewendet werden können und nicht im Zugriff auf bereits bestehende Projekte.
Inwieweit trägt PROJECT TOGO zum Klimaschutz bei?
Anzeigen
Schliessen
Das Klimaschutzprojekt PROJECT TOGO verfolgt die Vision, aktiven Klimaschutz mit der Verbesserung von sozialen Strukturen zu verbinden. Neben der Funktion als Klimaschutzprojekt hat sich das Projekt zu einem Regionen Projekt entwickelt und erfüllt mittlerweile 12 der 17 Global Goals. Gemeinsam mit der Unterstützung engagierter Menschen und Unternehmen realisiert das POROJECT TOGO selbsttragende Wertschöpfungseinheiten: Anlagen für die Energieerzeugung, Wasserversorgung und Bodenverbesserung, Infrastrukturen für Gesundheit und Bildung, Projekte für nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Selbstversorgungs- und Marktproduktion. Das Herzstück von PROJECT TOGO besteht aus der Naturwaldaufforstung. Ziel der Tätigkeit ist die Pflanzung einheimischer Baumarten zur Schaffung einer Naturschutzzone, die sich langfristig in einen Naturwald entwickelt. Auf einer Fläche von 1.000 ha wurden seit Projektbeginn im Jahre 2012 ca. 2 Millionen Bäume gepflanzt. Bei den Bäumen handelt es sich ausschließlich um in der Region heimische Arten.